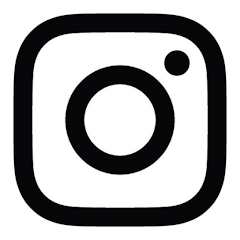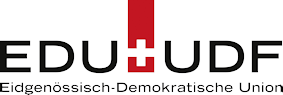Deshalb muss der «Lehrplan vors Volk»
Der Zürcher Bote, Freitag 16. Oktober 2015
Anita Borer, Kantonsrätin SVP, Vertreterin Initiativkomitee Uster
Solide Schulbildung ist wichtig und darf uns nicht egal sein. Sie ist das Fundament unserer sonst ressourcenarmen Schweiz. Deshalb ist es nur legitim, dass die Bevölkerung bei diesem Fundament mitreden kann. Die Initiative «Lehrplan vors Volk» fordert genau das.
Auch wenn die eigene Schulzeit bereits Jahre zurückliegt und vielleicht auch die Kinder nicht mehr zur Schule gehen, ist jeder und jedem bewusst: Gut ausgebildete Bürgerinnen und Bürger sind der Nährboden unserer Gesellschaft, unseres friedlichen Zusammenlebens und Bedingung für einen gut funktionierenden Unternehmensstandort Schweiz.
Damit diese Bildung nach System verläuft und letztlich auch wichtige Grundlagen erlernt werden, liegt dem Schulunterricht ein Lehrplan zugrunde, an welchem sich die Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht zu orientieren haben. Bisher enthielt dieser einleuchtende, normal verständliche Ziele, über welche die Kantone die Obhut hatten. Damit soll jetzt Schluss sein, denn nun soll der von der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK) lancierte Lehrplan 21, welcher auf etlichen schwammig formulierten Kompetenzzielen aufgebaut ist, in allen Kantonen eingeführt werden, ohne dass die einzelnen Kantone noch viel dazu zu sagen haben.
Initiative im Endspurt
Wie bereits einmal an dieser Stelle erläutert, wehrt sich – nebst vielen anderen Kantonen – auch im Kanton Zürich ein überparteiliches Komitee, bestehend aus Partei-, Schul- und Elternvertretern, mit einer Volksinitiative gegen dieses übermässige, realitätsfremde Bürokratiewerk «Lehrplan 21». Die Initiative verlangt, dass im Kanton Zürich über die Einführung des Lehrplans 21 bzw. dessen Inhalte abgestimmt werden kann. Der Kantonsrat (und nicht wie bisher der Bildungsrat) soll gemäss Initiativtext den kantonalen Lehrplan genehmigen. Weiter soll der Kantonsratsbeschluss, mit welchem der Lehrplan genehmigt wird, referendumsfähig sein. Das Volk hätte somit abschliessend die Gelegenheit, über den kantonalen Lehrplan abzustimmen.
Die Unterschriftensammlung für die Initiative ist bereits seit Mai 2015 im Gange und dauert noch bis Ende November 2015 an. Es gilt nun, voller Elan die noch verbleibenden Unterschriften einzuholen, um die demokratische Mitbestimmung zugunsten einer guten Schule zu stärken.
Hilfestellung und Begrifflichkeiten
Unterschriften sammeln ist eine Kunst. Man muss die Leute richtig ansprechen und dann auch noch ein paar gute Argumente auf Lager haben. Viele Begriffe und Umstände im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 sind nicht einfach zu erklären. Als Vertreterin des Initiativkomitees möchte ich mit nachfolgenden Argumenten, die im Zusammenhang mit dem Lehrplan wichtig sind, eine Hilfestellung bieten und bin dankbar, wenn Sie uns im Endspurt damit nochmals tatkräftig unterstützen.
Demokratische Mitbestimmung wahren
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmten in den vergangenen Jahren über diverse bildungspolitische Vorlagen wie zum Beispiel die Grundstufe, Mundart im Kindergarten und Klassengrösse ab. Sie fällten weise Entscheide, die von einer Mehrheit in unserem Kanton getragen werden. Es ist dem Kantonsrat bzw. dem Volk zuzutrauen, dass es den Lehrplan, die Grundlage unserer Schule, beurteilen und dazu ja oder nein sagen kann. Dem vermehrt einkehrenden Trend, die Bevölkerung bei bildungspolitischen Entscheiden auszuschliessen, ist vehement entgegenzuhalten. Die D-EDK, welche den Lehrplan 21 «erschaffen» hat, ist ein Beispiel für ein Gremium, das ohne demokratische Legitimation wichtige bildungspolitische Grundlagen gesamtschweizerisch vorgibt und über die Köpfe der demokratisch gewählten Instanzen in den Kantonen verfügt (die einzelnen Vertreter der D-EDK wurden zwar in den entsprechenden Kantonen als Kantonsvertreter gewählt, allerdings nicht als Entscheidungsgremium an sich).
Sinnvolle Harmonisierung sicherstellen
Mit Annahme des Bildungsartikels in der Bundesverfassung und dem Beitritt zum Harmos-Konkordat hat die Bevölkerung des Kantons Zürich zum Ausdruck gebracht, dass sie eine gewisse Harmonisierung des Bildungswesens wünscht. So bestreitet zum Beispiel niemand, dass eine gleich lange Schuldauer in der ganzen Schweiz Sinn macht.
Der Lehrplan 21 wird einer sinnvollen Vereinheitlichung allerdings nicht gerecht. Weder im Bildungsartikel noch im Harmos-Konkordat ist die Rede von einem umfassenden Lehrplan, welcher unter dem Deckmantel der Harmonisierung für alle Kantone gelten soll. Der aktuelle Lehrplan 21 untergräbt jeglichen Gestaltungsspielraum der Kantone. Zudem werden im Lehrplan 21 keine Jahresziele, sondern Zyklusziele vorgegeben, die drei bis vier Jahre umfassen. Ein Umzug innerhalb einer Gemeinde, eines Kantons oder verschiedener Kantone wird dadurch nicht erleichtert, sondern sogar erschwert.
Kantonale Bildungshoheit wahren
In der Bundesverfassung, Artikel 62, ist die kantonale Bildungshoheit verankert, die besagt, dass die Kantone für die Bildung zuständig sind. Dieser Grundsatz wurde durch die Annahme des Bildungsartikels 2006 in einer Volksabstimmung erneut bestätigt. Es hat sich gezeigt, dass sich durch den institutionellen Wettbewerb zwischen den Kantonen letztlich die besten Lösungen herauskristallisieren und bewähren können. Mit dem Lehrplan 21 soll allen Kantonen etwas aufoktroyiert werden, womit die kantonale Bildungshoheit letztlich untergraben wird. Der Wettbewerb schwindet, wodurch schlechte Lösungen institutionalisiert werden und nur schwierig wieder anzupassen sind.
Unsinnige Reformen stoppen
Damit die Qualität der Schulbildung gewährleistet werden kann, müssen deren Grundlagen immer wieder hinterfragt und gegebenenfalls verbessert werden. Dies bezieht sich auch auf die gesetzlichen Vorgaben.
Der Lehrplan 21 ist allerdings keine Verbesserung, sondern eine der grössten Reformen der vergangenen Jahre. Sie bindet die Ressourcen der Lehrpersonen, hat die Steuerzahler bereits gekostet und wird künftig noch einige Investitionen nach sich ziehen.
Die Schulreformen der letzten Jahre haben das Mass zum Überlaufen gebracht. Zu viele Experimente haben letztlich zu einer Verschlechterung unseres Bildungssystems geführt, sodass die Schulabgänger trotz Mehrausgaben nicht mehr das nötige Rüstzeug für die weitere Bildung oder das Berufsleben mit bringen. Damit muss endlich Schluss sein.
Guten Schulunterricht ermöglichen
Der Lehrplan soll gut verständliche Jahrgangsziele festhalten. Dem Lehrer soll zur Zielerreichung Methodenfreiheit zugestanden werden. Leistungsorientiertes, konzentriertes Lernen, welches von einer Klassenlehrperson angeleitet wird, ist für eine gute Schulbildung unumgänglich.
Mit dem Lehrplan 21 geschieht Gegenteiliges. Selbstentdeckendes, individualisiertes Lernen soll eingeführt werden. Der Schüler soll demnach entscheiden, was wie wann und ob er überhaupt lernen will. Der Lehrer wird zum Lernbegleiter degradiert, und Klassenunterricht ist nicht mehr zentral.
Unzählige diffus formulierte und von Bildungsfachleuten infrage gestellten «Kompetenzen» stehen beim Lehrplan 21 im Vordergrund. Grundlegende für das Berufsleben wichtige Kenntnisse und Fertigkeiten (Einmaleins, Prozentrechnen, Schreibsicherheit usw.) sind nicht mehr zentral. Gute Schule bedingt entsprechende Grundlagen, die in der Bevölkerung breit abgestützt sind. Mit der Initiative «Lehrplan vors Volk» hat jede und jeder noch eine Gelegenheit, mitzureden. Diese Chance gilt es zu nutzen. Unterstützen Sie deshalb die Initiative «Lehrplan vors Volk» und unterschreiben Sie noch heute.